Smartphones ohne Google? Für viele klingt das zunächst ungewohnt, vielleicht sogar unbequem. Für andere ist es ein bewusst gewählter Schritt in Richtung mehr Datenschutz, Kontrolle und Unabhängigkeit von einer großen US-Plattform. In diesem Text schauen wir uns an, wer heute schon Handys ohne Googles Ökosystem anbietet, welche Alternativen es zu den bekannten Google-Diensten gibt und welche Vor- und Nachteile ein solcher Wechsel für deinen Alltag mit sich bringt. Ich schreibe in einem freundlichen Ton und spreche dich direkt mit „du“ an — so, wie es auf Addis Techblog üblich ist.
Warum überhaupt ein Smartphone ohne Google?
Google hat mit Android und seinen Google Mobile Services (GMS) eine dominante Plattform geschaffen. Auf den meisten Android-Geräten sind Play Store, Maps, Gmail, Drive, Play Services und eine Reihe unsichtbarer Hintergrunddienste vorinstalliert. Diese Dienste bieten Komfort: einfache App-Installation, Push-Benachrichtigungen, App-Sicherheitsscans und tiefe Integration mit Konto- und Cloudfunktionen. Andererseits bedeutet das auch eine starke Abhängigkeit von einem Konzern, der über sehr viele Daten verfügt und durch seine Geschäftsmodelle wirtschaftlich genau daran interessiert ist. Manche Nutzer möchten weniger Telemetrie, mehr Kontrolle über ihr Gerät oder komplett andere App-Ökosysteme nutzen. Andere Länder und Hersteller sehen geopolitische Gründe oder regulatorischen Druck als Anlass, eigene Wege zu gehen.
Wer bietet Smartphones ohne Google an?

Die bekannteste Geschichte in diesem Feld ist Huawei. Wegen US-Handelsbeschränkungen und Blacklist-Massnahmen hat Huawei seinen Weg weg von der kompletten Google-Abhängigkeit seit einigen Jahren konsequent vorangetrieben. Das Unternehmen hat sein eigenes Betriebssystem HarmonyOS und die App-Distribution AppGallery massiv ausgebaut. Huawei hat ambitionierte Ziele formuliert, um ein reichhaltiges App-Ökosystem aufzubauen und die nationale sowie internationale Abhängigkeit von fremden Plattformen zu reduzieren.
Es gibt außerdem spezialisierte Anbieter und Communities, die explizit Geräte ohne Google-Services verkaufen oder unterstützen. Purism zum Beispiel produziert das Librem 5 mit einem vollständig freien Linux-basierten Betriebssystem. Auch Projekte wie PinePhone (von Pine64) oder Geräte mit alternativen freien Systemen wie /e/OS, LineageOS, CalyxOS oder GrapheneOS richten sich an Nutzer, die ein „degoogled“ Telefon wollen — teils mit mehr Fokus auf Privatsphäre, teils auf Freiheit und Offenheit der Software. Diese Angebote sind oft technikaffiner als die typischen Android-Mainstream-Modelle, aber sie zeigen klar: eine Alternative ist technisch machbar.
Welche Alternativen gibt es zu Google-Diensten — praktisch betrachtet?
Wenn du ein Gerät ohne Google-Ökosystem nutzt, musst du Ersatzlösungen für zentrale Funktionen finden. Für Apps und deren Verteilung existieren mehrere Wege: manche Hersteller betreiben eigene App-Stores wie Huaweis AppGallery, Samsung hat den Galaxy Store, Amazon bietet im Prime-Ökosystem den Amazon Appstore an, und es gibt unabhängige Repositorien wie F-Droid für freie Software oder alternative Frontends wie Aurora Store, die APKs aus dem Google Play-Katalog holen können. All diese Wege haben Vor- und Nachteile: Auswahl und Komfort unterscheiden sich deutlich, und nicht jede App ist überall verfügbar.
Für Kern-Dienste wie Suche, Mail, Karten und Cloud gibt es ebenfalls Alternativen. Als Suchmaschine kannst du auf DuckDuckGo, Bing oder Brave Search zurückgreifen. Mail lässt sich mit ProtonMail, Tutanota oder klassischen IMAP/SMTP-Konten abdecken. Karten- und Navigationsdienste basieren oft auf OpenStreetMap-Daten und werden in Apps wie OsmAnd, Magic Earth oder HERE Maps genutzt. Für Cloud-Speicher gibt es Nextcloud als stark datenschutzorientierte, selbst hostbare Alternative zu Google Drive. Viele dieser Dienste sind weniger integriert als Googles Ökosystem, aber sie geben dir Kontrolle über Daten und Speicherort.
Technisch sensibel ist die Frage nach Push-Benachrichtigungen und Hintergrunddiensten: Viele Android-Apps setzen auf Google Play Services (GMS) für Push-Messaging (Firebase Cloud Messaging) oder für standortbasierte Funktionen. Ohne GMS musst du oft auf herstellerspezifische Lösungen, individualisierte Push-Bridges oder Projekte wie microG zurückgreifen, die einige GMS-Funktionen nachbilden. Diese Lösungen arbeiten unterschiedlich zuverlässig und sind oft weniger bequem einzurichten als die Standard-Google-Integration.
Chancen: Was spricht für ein Leben ohne Google?
Der wichtigste Grund ist Privatsphäre-Gewinn. Wenn du Google-Dienste entfernst, reduzierst du automatisch eine große Quelle an Telemetrie und personalisiertem Tracking. Dadurch erhältst du mehr Kontrolle darüber, welche Daten an Dritte fließen und wie sie verwendet werden.
Ein weiterer Vorteil ist ökonomische und geopolitische Diversifikation. Hersteller wie Huawei versuchen, eigene Ökosysteme aufzubauen, um unabhängiger von US-Technologie zu werden. Das kann in bestimmten Ländern oder bei bestimmten Nutzungsanforderungen von Vorteil sein. Gleichzeitig schaffen alternative Anbieter und offene Projekte mehr Wettbewerb und Vielfalt auf dem Markt.
Für Power-User bietet ein „degoogled“ Gerät technische Freiheit. Du kannst System-Komponenten austauschen, Updates selbst verwalten und oft genau sehen, welche Software wirklich auf dem Gerät läuft. Geräte mit alternativen Systemen oder Linux-Phones sind zudem oft auf Langlebigkeit und Reparierbarkeit ausgelegt — ein Nachhaltigkeitsaspekt, der immer wichtiger wird.
Herausforderungen: Was wird schwieriger?
Der größte Nachteil ist Alltagskomfort. Viele populäre Apps erwarten Google-Dienste: Banking-Apps, bestimmte Messenger-Funktionen, Play-abhängige Spiele oder Apps mit tiefem Integrationsbedarf funktionieren nicht out-of-the-box. Manche Banken prüfen Gerätezustand und Sicherheitszertifikate über Google-APIs; ohne GMS kann das zu Sperren führen.
Sicherheit und App-Qualität sind ebenfalls Herausforderungen. Google Play Protect und das Play-Ökosystem führen automatische Malware-Scans, Sicherheitsupdates und eine zentrale Entwickler-Infrastruktur. Alternative Stores und Side-Loading bringen die Notwendigkeit, Quellen und APKs sorgfältig zu prüfen. Das ist zwar technisch lösbar, erfordert aber mehr Aufmerksamkeit vom Nutzer.
Fragmentierung ist ein weiteres Problem. Wenn Hersteller eigene Ökosysteme oder Betriebssysteme vorantreiben, entstehen inkompatible Standards. Das kann für App-Entwickler einen Mehraufwand bedeuten und damit die App-Auswahl für Nutzer einschränken. Im europäischen Kontext greifen regulatorische Entwicklungen wie die Digital Markets Act (DMA) und jüngste EU-Entscheidungen, die Googles Verhalten gegenüber Drittanbietern adressieren. Diese regulatorischen Schritte können langfristig die Position großer Plattformen verändern und damit auch die Praktikabilität von Alternativen beeinflussen.
Konkrete Alltagstipps, wenn du auf Google verzichten willst
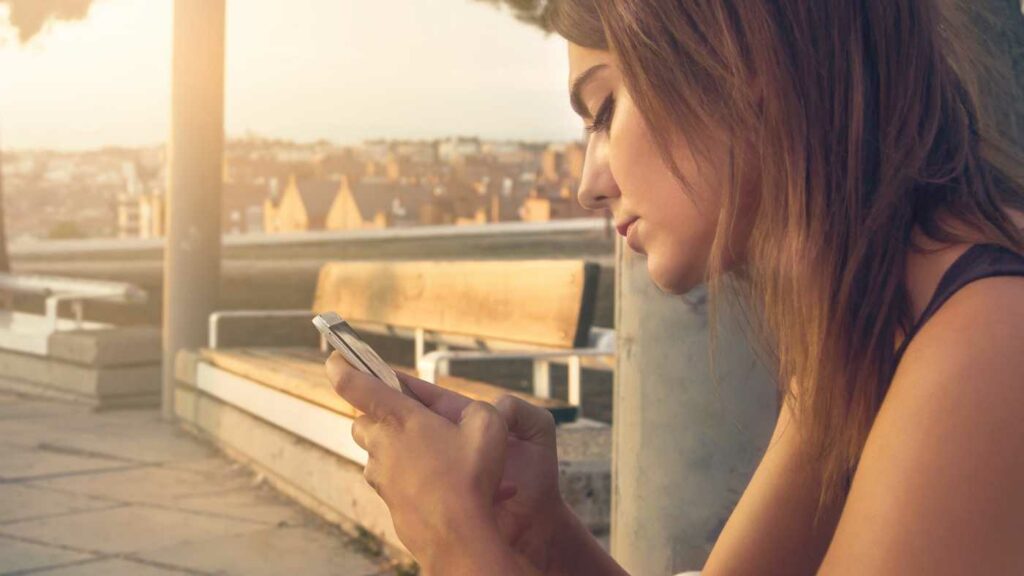
Wenn du ernsthaft darüber nachdenkst, ein Smartphone ohne Google zu nutzen, überlege zunächst, welche Funktionen für dich unverzichtbar sind. Kannst du auf die Komfortfunktionen von Google Maps verzichten, oder benötigst du Google Pay für Zahlungsfunktionen? Prüfe im Vorfeld, ob deine wichtigsten Apps auch in alternativen App-Stores verfügbar sind oder ob es gleichwertige Ersatz-Apps gibt.
Für Push-Benachrichtigungen und Messaging solltest du Tests durchführen: Manche Apps bieten eigene Push-Mechaniken oder funktionieren über servergestützte Web-Notifications. Banking-Apps solltest du unbedingt im Voraus testen, da Sicherheitsprüfungen dort oft restriktiv sind. Wenn du auf bequeme Backups angewiesen bist, richte eine Nextcloud-Instanz oder ein anderes Backup-Tool ein, denn die automatische Sicherung über Google Drive entfällt.
Wenn du technische Erfahrung mitbringst, sind Lösungen wie LineageOS, GrapheneOS oder /e/OS eine gute Wahl, denn sie kombinieren Android-Kompatibilität mit geringerem Google-Footprint. Für maximale Sicherheit sind jedoch spezialisierte Projekte wie GrapheneOS empfehlenswert, die auf Vertraulichkeit, Härtung und minimale Angriffsfläche setzen. Für ein vollständig alternatives Ökosystem gibt es zudem Linux-Phones wie das Librem 5 — das ist aber weniger „Plug & Play“ und richtet sich an Enthusiasten.
Regulierung und Wirtschaft: Wird der Markt sich ändern?
Die EU war in den letzten Jahren eine treibende Kraft, um die Marktmacht großer Plattformen zu begrenzen. Verfahren gegen Google, Anpassungen der Play-Richtlinien und die Digital Markets Act zielen darauf ab, Wettbewerb zu stärken und Drittanbietern mehr Freiheiten zu geben. Solche Eingriffe können mittelfristig die Dominanz von Google schwächen, was wiederum Alternativen leichter zugänglich machen würde. Ob und wie schnell das geschieht, hängt aber sowohl von rechtlicher Durchsetzung als auch von Marktreaktionen ab. Aktuelle Entscheidungen zeigen jedenfalls, dass regulative Kräfte aktiv sind — das kann langfristig dazu führen, dass Geräte ohne Google einfacher in den Alltag integriert werden können.
Fazit: Für wen lohnt sich ein Verzicht auf Google?

Ein Gerät ohne Google lohnt sich für dich, wenn Privatsphäre, Kontrolle und die Bereitschaft, technische Kompromisse einzugehen, im Vordergrund stehen. Wenn du bereit bist, mehr Zeit in das Konfigurieren, Testen und gelegentlichere Troubleshooting zu investieren, bekommst du ein Gerät, das weniger Daten nach Hause funkt und sich freier an deine Bedürfnisse anpassen lässt.
Wenn dein Alltag jedoch stark von bestimmten Apps oder Bankfunktionen abhängt, oder du einfach maximale Bequemlichkeit erwartest, ist ein vollständiger Verzicht auf Google vermutlich nicht die beste Wahl. Für viele Nutzer ist ein Mittelweg attraktiv: ein Android-Gerät mit alternativen App-Stores und datenschutzfreundlichen Apps, kombiniert mit gezielter Deaktivierung von Tracking und Nutzung datenschutzfreundlicher Dienste, bietet einen guten Kompromiss zwischen Komfort und Kontrolle.
Der Markt entwickelt sich weiter: Hersteller wie Huawei bauen unabhängige Ökosysteme aus, es entstehen Communities und Projekte, die „degoogling“ praktikabler machen, und politische Regulierung übt Druck auf dominante Plattformen aus. Kurzfristig ist der Wechsel technisch möglich, aber mit Aufwand verbunden. Mittelfristig könnten regulatorische Maßnahmen und wachsendes Nutzerinteresse die Hürden deutlich senken.

















