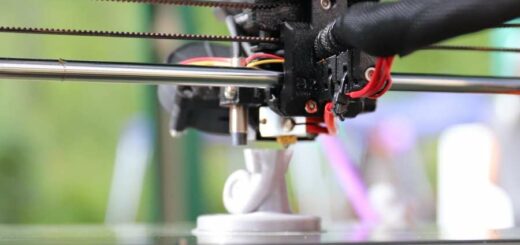Du erinnerst dich vielleicht an meinen Blogpost über DNS – das Domain Name System, das dafür sorgt, dass du einfach „google.com“ eingeben kannst, anstatt dir kryptische Zahlenkombinationen merken zu müssen. Dort habe ich kurz erwähnt, dass DNS im Grunde Namen in IP-Adressen übersetzt. Aber was sind IP-Adressen eigentlich? Warum brauchen wir sie? Und was hat es mit diesem mysteriösen IPv6 auf sich, von dem alle reden, aber das niemand so richtig zu nutzen scheint?
Zeit für einen ausführlichen Deep-Dive in die Welt der IP-Adressen! Schnapp dir einen Kaffee oder Tee, denn heute gehen wir der digitalen Postanschrift des Internets auf den Grund.
Was ist eine IP-Adresse eigentlich wirklich?

Stell dir das Internet wie eine riesige Stadt vor. In dieser Stadt gibt es Milliarden von Häusern – dein Smartphone, dein Laptop, die Server von Netflix, die Website deiner Lieblingszeitung, und so weiter. Damit Datenpakete von einem Haus zum anderen finden können, braucht jedes dieser Häuser eine eindeutige Adresse. Genau das ist eine IP-Adresse: deine digitale Postanschrift im Netz.
IP steht für „Internet Protocol“ – also das Regelwerk, nach dem Daten im Internet verschickt werden. Eine IP-Adresse ist eine einzigartige Zahlenfolge, die deinem Gerät zugewiesen wird, sobald es sich mit einem Netzwerk verbindet. Sie ermöglicht es, dass Datenpakete den Weg zu deinem Gerät finden und nicht bei deinem Nachbarn landen.
Wenn du eine Website aufrufst, passiert Folgendes: Dein Browser fragt zunächst einen DNS-Server „Hey, wie lautet die IP-Adresse von addis-techblog.de?“ Der DNS-Server antwortet mit der entsprechenden IP-Adresse, und dann schickt dein Browser eine Anfrage an diese IP-Adresse. Der Webserver unter dieser Adresse antwortet mit den gewünschten Daten – und schon siehst du die Website auf deinem Bildschirm.
Das Ganze funktioniert ähnlich wie das Versenden eines Briefes: Du schreibst die Empfängeradresse drauf, wirfst ihn in den Briefkasten, und das Postsystem sorgt dafür, dass er ankommt. Die IP-Adresse ist dabei sowohl die Empfängeradresse als auch deine Absenderadresse, damit die Antwort zurück zu dir findet.
IPv4 vs. IPv6: Der große Umzug, der ewig dauert
Jetzt wird es spannend, denn es gibt nicht nur eine Art von IP-Adressen, sondern gleich zwei verschiedene Versionen: IPv4 und IPv6. Das ist ein bisschen so, als hätte man in der Stadt erst Adressen mit Straßenname und Hausnummer eingeführt (IPv4), und dann gemerkt, dass die Hausnummern nicht mehr ausreichen, weil es so viele neue Häuser gibt. Also hat man ein komplett neues Adressierungssystem erfunden (IPv6).
IPv4: Der Klassiker mit Platzproblem
IPv4 (Internet Protocol Version 4) ist das Original und existiert seit 1981 – ja, richtig gelesen, das ist älter als die meisten von uns! Eine IPv4-Adresse besteht aus vier Zahlen zwischen 0 und 255, die durch Punkte getrennt sind. Ein Beispiel: 192.168.1.1 oder 8.8.8.8 (das ist übrigens ein DNS-Server von Google).
Das Problem mit IPv4? Es gibt nur etwa 4,3 Milliarden mögliche Adressen. Das klingt nach wahnsinnig viel, aber bedenke mal: Auf der Welt gibt es über 8 Milliarden Menschen, und viele von uns haben mehrere internetfähige Geräte – Smartphone, Laptop, Tablet, Smart TV, Smart Home Geräte, und so weiter. Die IPv4-Adressen sind praktisch aufgebraucht. Tatsächlich wurden die letzten IPv4-Adressen in Europa bereits 2019 offiziell vergeben.

Aber wie funktioniert das Internet dann noch? Ganz einfach: durch einen cleveren Trick namens NAT (Network Address Translation). Dein Router zu Hause bekommt eine öffentliche IPv4-Adresse von deinem Internetanbieter, und alle deine Geräte teilen sich diese Adresse. Der Router verwaltet intern, welches Gerät welche Daten angefordert hat, und leitet die Antworten entsprechend weiter. Es ist wie ein großes Mehrfamilienhaus mit nur einer Straßenadresse – der Hausmeister (dein Router) sorgt dafür, dass die Post beim richtigen Mieter landet.
IPv6: Die Zukunft, die schon lange da ist (aber noch nicht überall)
Um das Adressproblem zu lösen, wurde bereits 1998 (!) IPv6 entwickelt. Und dieses neue System denkt wirklich groß: IPv6 bietet etwa 340 Sextillionen Adressen. Das ist eine Zahl mit 39 Nullen! Damit könnte man jedem Sandkorn auf der Erde eine eigene IP-Adresse geben – und hätte immer noch welche übrig.
Eine IPv6-Adresse sieht deutlich anders aus als IPv4. Sie besteht aus acht Gruppen von jeweils vier hexadezimalen Zeichen (also Zahlen von 0-9 und Buchstaben von A-F), getrennt durch Doppelpunkte. Ein Beispiel: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Das sieht kompliziert aus, hat aber einen großen Vorteil: Es gibt so viele Adressen, dass NAT nicht mehr nötig ist. Jedes deiner Geräte kann eine eigene, weltweit eindeutige IP-Adresse haben.
Warum dauert der Wechsel so lange?
Hier wird es interessant: IPv6 wurde vor fast 30 Jahren entwickelt, aber im November 2025 nutzen weltweit immer noch erst etwa 45 bis 49 Prozent der Internetnutzer IPv6 – und das auch nur teilweise. In Deutschland liegt die Adoptionsrate bei etwa 75 Prozent, in Frankreich bei beeindruckenden 78 Prozent, während China mit unter 5 Prozent weit hinten liegt.
Warum geht es so langsam voran? Das liegt an mehreren Faktoren. Erstens funktioniert IPv4 mit NAT immer noch – es gibt also keinen akuten Notfall. Zweitens ist die Umstellung teuer und aufwendig: Alte Router, Switches und andere Netzwerkgeräte müssen ausgetauscht werden. Drittens sind IPv4 und IPv6 nicht direkt kompatibel – sie können nicht einfach so miteinander kommunizieren. Deshalb müssen viele Netzbetreiber und Websites beide Systeme parallel betreiben (Dual-Stack genannt), was die Komplexität erhöht.
Interessanterweise sind es vor allem Mobilfunkanbieter und große Internetdienstleister, die IPv6 vorantreiben. Wenn du mit deinem Smartphone im mobilen Netz surfst, nutzt du wahrscheinlich bereits IPv6, ohne es zu merken. Große Content-Anbieter wie Google, Facebook oder Netflix unterstützen ebenfalls beide Protokolle.
Ein weiterer Grund für die schleppende Umstellung: Für Unternehmen ist der Business-Case schwierig. IPv4 funktioniert, und der Wechsel zu IPv6 bringt kurzfristig keine sichtbaren Vorteile für die Kunden. Erst wenn IPv4 wirklich nicht mehr ausreicht oder Regierungen den Wechsel vorschreiben, wird sich die Umstellung beschleunigen. Die US-Regierung hat beispielsweise 2020 angeordnet, dass bis 2025 mindestens 80 Prozent der Bundesbehörden auf IPv6-only umgestellt sein müssen – ein Schritt, der auch Partner und Zulieferer zum Handeln zwingt.
Öffentliche vs. private IP-Adressen: Das Haus im Haus
Jetzt wird es etwas komplexer, aber bleib dran – das Verständnis von öffentlichen und privaten IP-Adressen ist super wichtig!
Öffentliche IP-Adressen
Deine öffentliche IP-Adresse ist die Adresse, unter der du im Internet sichtbar bist. Sie wird dir von deinem Internetanbieter (ISP) zugeteilt und ist weltweit einzigartig. Wenn du eine Website besuchst, sieht diese deine öffentliche IP-Adresse und kann damit zum Beispiel feststellen, aus welchem Land du ungefähr surfst.
Denk an die öffentliche IP wie an deine Straßenadresse: Jeder kann Briefe dorthin schicken, und die Post weiß, wie sie dich erreicht. Deine öffentliche IP-Adresse ermöglicht es Servern im Internet, Daten an dein Netzwerk zu schicken.
Private IP-Adressen
Private IP-Adressen sind dagegen nur innerhalb deines lokalen Netzwerks gültig. Dein Router vergibt sie an alle Geräte in deinem Heimnetzwerk – Laptop, Smartphone, Smart TV, und so weiter. Diese Adressen sind nicht weltweit eindeutig. Das heißt, dein Laptop hat zu Hause vielleicht die IP 192.168.1.100, und genau die gleiche Adresse hat auch der Laptop deines Nachbarn – aber das ist kein Problem, weil die Geräte in unterschiedlichen Netzwerken sind.
Es gibt spezielle Adressbereiche, die für private Netzwerke reserviert sind. Die bekanntesten sind:
Für private Heimnetzwerke:
- 10.0.0.0 bis 10.255.255.255 (große Netzwerke)
- 172.16.0.0 bis 172.31.255.255 (mittlere Netzwerke)
- 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 (kleine Netzwerke, wie dein WLAN zu Hause)
Diese Adressen funktionieren wie Wohnungsnummern in einem Mehrfamilienhaus: Die Straßenadresse (öffentliche IP) ist für alle gleich, aber jede Wohnung (Gerät) hat ihre eigene Nummer innerhalb des Hauses.
Wenn du jetzt von deinem Laptop aus eine Website besuchst, passiert Folgendes: Dein Laptop schickt die Anfrage an deinen Router (über die private IP), der Router packt sie ein und schickt sie mit deiner öffentlichen IP ins Internet. Die Antwort kommt zurück an deine öffentliche IP, und der Router leitet sie dann wieder an die private IP deines Laptops weiter. Das ist NAT in Aktion!
Statische vs. dynamische IPs: Umzugsstress oder Dauerwohnsitz?
Nicht alle IP-Adressen sind gleich. Manche bleiben fest, andere wechseln regelmäßig. Das hat praktische Gründe und Auswirkungen auf dein Nutzungserlebnis.
Dynamische IP-Adressen: Die häufige Variante
Die meisten Privathaushalte bekommen von ihrem Internetanbieter eine dynamische IP-Adresse zugewiesen. Das bedeutet, dass sich deine öffentliche IP-Adresse regelmäßig ändert – oft wenn du deinen Router neu startest oder nach einer bestimmten Zeit (meist 24 Stunden).
Warum machen die Anbieter das? Ganz einfach: Adressverwaltung. Nicht alle Kunden sind gleichzeitig online, also können die Anbieter ihre begrenzten IPv4-Adressen effizienter nutzen. Es ist wie ein Parkplatz-System: Wenn jemand wegfährt, kann der nächste den Platz nutzen.
Für dich als Nutzer hat das kaum Nachteile. Du surfst, streamst und arbeitest wie gewohnt. Der einzige Fall, wo eine dynamische IP problematisch sein kann, ist wenn du von außen auf dein Heimnetzwerk zugreifen möchtest – etwa auf einen eigenen Webserver, ein NAS-System oder eine IP-Kamera. Dann musst du entweder einen Dynamic DNS-Dienst nutzen oder andere Lösungen finden.
Statische IP-Adressen: Die feste Adresse
Eine statische IP-Adresse bleibt immer gleich. Das ist nützlich für Server, Websites und Unternehmen, die ständig erreichbar sein müssen. Stell dir vor, eine Website würde ihre IP-Adresse täglich wechseln – der DNS-Eintrag müsste ständig aktualisiert werden, und das wäre ein Chaos.
Als Privatperson brauchst du normalerweise keine statische IP-Adresse. Falls doch, kannst du sie bei den meisten Internetanbietern gegen eine zusätzliche monatliche Gebühr (oft 5 bis 10 Euro) buchen. Das lohnt sich vor allem, wenn du eigene Serverdienste betreibst oder häufig Fernzugriff auf dein Heimnetzwerk brauchst.
Was hast du? In den allermeisten Fällen hast du eine dynamische öffentliche IP-Adresse. Deine privaten IP-Adressen im Heimnetzwerk sind übrigens auch meistens dynamisch – dein Router vergibt sie per DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) an deine Geräte, wenn sie sich mit dem WLAN verbinden. Du kannst aber in den Router-Einstellungen auch statische private IPs für bestimmte Geräte festlegen, was manchmal praktisch ist.
Kann man über die IP-Adresse zurückverfolgt werden?
Jetzt kommen wir zu einer Frage, die viele beschäftigt: Wie viel verrät meine IP-Adresse eigentlich über mich? Kann mich jemand damit aufspüren?
Die kurze Antwort: Ja, aber nicht so einfach, wie es in Filmen oft dargestellt wird.
Was eine IP-Adresse verraten kann
Deine IP-Adresse ist kein großes Geheimnis. Jede Website, die du besuchst, jeder Online-Dienst, den du nutzt, kann deine öffentliche IP-Adresse sehen – das ist technisch notwendig, damit die Daten zurück zu dir finden. Mit deiner IP-Adresse können verschiedene Dinge herausgefunden werden:
Ungefährer Standort: Über sogenannte Geolokalisierungs-Datenbanken kann man aus einer IP-Adresse das Land, oft die Region oder Stadt und manchmal sogar die Postleitzahl ableiten. Das ist aber nicht präzise wie GPS – es zeigt nur, wo sich der Server deines Internetanbieters befindet, nicht deine exakte Wohnadresse. Die Genauigkeit liegt oft bei 50 bis 100 Kilometern.
Internetanbieter: Man kann leicht herausfinden, welchen ISP du nutzt – also ob du bei Telekom, Vodafone, oder einem anderen Anbieter bist.
Art der Verbindung: Manchmal lässt sich erkennen, ob du über Kabel, DSL, Mobilfunk oder ein Firmennetzwerk verbunden bist.
Ungefähre Zeitzone: Daraus kann man Rückschlüsse auf deine aktive Zeit und Gewohnheiten ziehen.
Was eine IP-Adresse NICHT verrät
Eine IP-Adresse verrät nicht direkt deinen Namen, deine genaue Adresse, deine Telefonnummer oder andere persönliche Daten. Diese Informationen sind bei deinem Internetanbieter gespeichert und unterliegen dem Datenschutz.
Allerdings – und jetzt wird es wichtig – können Behörden mit einem richterlichen Beschluss deinen Internetanbieter dazu verpflichten, die zu einer IP-Adresse gespeicherten Kundendaten herauszugeben. Das passiert bei schweren Straftaten wie Kinderpornografie, Terrorismus oder massiven Cyberangriffen. Für Bagatelldelikte ist das in Deutschland und der EU nicht erlaubt.
Seit 2025 gelten IP-Adressen in der EU unter der GDPR (General Data Protection Regulation, besser bekannt als DSGVO) als personenbezogene Daten. Das heißt, Unternehmen müssen vorsichtig damit umgehen und dürfen sie nicht ohne weiteres speichern, weitergeben oder für Tracking nutzen – zumindest nicht ohne deine Einwilligung.
Tracking und Profiling
Das größere Privacy-Problem ist nicht die Rückverfolgung zur Person, sondern das Tracking. Websites, Werbenetzwerke und Datenbroker nutzen IP-Adressen zusammen mit Cookies und anderen Techniken, um ein detailliertes Profil deines Online-Verhaltens zu erstellen. Sie tracken, welche Seiten du besuchst, wie lange du dort bleibst, was du kaufst, wonach du suchst.
Diese Profile werden für personalisierte Werbung genutzt und manchmal sogar verkauft. Das ist legal, solange es nach den Datenschutzregeln passiert – aber viele finden es trotzdem unangenehm. Daher die Cookie-Banner, die seit der DSGVO überall auftauchen.
Besonders problematisch wird es, wenn verschiedene Datenquellen kombiniert werden: IP-Adresse plus Cookies plus Social-Media-Login plus Kaufhistorie – dann entsteht ein sehr genaues Bild von dir als Person.
Sicherheitsrisiken
Für normale Nutzer ist die IP-Adresse kein großes Sicherheitsrisiko. Hacker können mit deiner IP allein nicht viel anfangen – sie können nicht einfach auf deinen Computer zugreifen oder deine Daten stehlen. Der Router und die Firewall schützen dich.
Allerdings können Angreifer mit deiner IP-Adresse sogenannte DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) durchführen – dabei wird dein Internetanschluss mit so vielen Anfragen überflutet, dass er überlastet ist. Das ist vor allem für Gamer, Streamer oder kleine Unternehmen relevant. Für Privatpersonen ist das Risiko gering.
Ein weiteres Risiko: Geotargeting. Manche Dienste blockieren oder beschränken Inhalte basierend auf deiner IP-Adresse. Netflix zeigt dir je nach Land unterschiedliche Inhalte, manche Websites sind aus bestimmten Ländern nicht erreichbar, und Preise in Online-Shops können je nach Standort variieren.
Wie finde ich meine IP-Adresse? Der komplette Guide für alle Geräte
Manchmal musst du deine IP-Adresse wissen – vielleicht für die Einrichtung eines Geräts, für Support-Anfragen oder einfach aus Neugier. Hier zeige ich dir, wie du sie auf allen gängigen Systemen findest.
Öffentliche IP-Adresse herausfinden
Das ist super einfach und funktioniert auf allen Geräten gleich: Öffne einfach einen Browser und gehe zu einer Website wie „wieistmeineip.de“ oder „whatismyipadress.com„. Diese Seiten zeigen dir sofort deine öffentliche IP-Adresse an – plus oft zusätzliche Infos wie deinen Standort und Internetanbieter.
Alternativ kannst du auch „Was ist meine IP“ in eine Suchmaschine eingeben. Google und andere Suchmaschinen zeigen dir deine IP direkt in den Suchergebnissen an.
Windows: Private IP-Adresse finden
Methode 1 – Die grafische Oberfläche: Klicke unten rechts auf das Netzwerk-Symbol in der Taskleiste, dann auf „Netzwerk- und Interneteinstellungen“. Klicke auf „Eigenschaften“ neben deiner aktuellen Verbindung (WLAN oder Ethernet). Scrolle nach unten bis zu „IPv4-Adresse“ – das ist deine private IP im lokalen Netzwerk.
Methode 2 – Die Kommandozeile (für Techies): Drücke Windows-Taste plus R, tippe „cmd“ und drücke Enter. Im schwarzen Fenster gibst du „ipconfig“ ein und drückst Enter. Suche nach dem Eintrag „IPv4-Adresse“ unter deiner aktiven Verbindung – das ist deine lokale IP.
macOS: Private IP-Adresse finden
Klicke oben links auf das Apple-Menü und dann auf „Systemeinstellungen“. Wähle „Netzwerk“. Wähle deine aktive Verbindung aus (WLAN oder Ethernet) – deine IP-Adresse wird direkt unter dem Verbindungsstatus angezeigt.
Für die Terminal-Variante: Öffne das Terminal (im Ordner „Programme/Dienstprogramme“) und gib „ifconfig“ ein. Bei der WLAN-Verbindung (meist „en0“) findest du deine IP neben „inet“.
Linux: Private IP-Adresse finden
Öffne ein Terminal und gib „ip addr“ oder das ältere „ifconfig“ ein. Deine IP-Adresse findest du unter deiner Netzwerk-Schnittstelle, meist „eth0“ für Kabel oder „wlan0“ für WLAN, neben dem Eintrag „inet“.
Android: Private IP-Adresse finden
Öffne die Einstellungen-App und tippe auf „Netzwerk & Internet“ oder „Verbindungen“. Tippe auf „WLAN“ und dann auf das verbundene Netzwerk (oft durch ein Zahnrad-Symbol gekennzeichnet). Scrolle nach unten – dort siehst du „IP-Adresse“. Das ist deine private IP im lokalen Netzwerk.
iOS (iPhone/iPad): Private IP-Adresse finden
Öffne die Einstellungen und tippe auf „WLAN“. Tippe auf das kleine „i“-Symbol neben deinem verbundenen Netzwerk. Unter „IP-Adresse“ siehst du deine private lokale IP.
Router-IP herausfinden
Die IP-Adresse deines Routers (auch Gateway genannt) brauchst du manchmal, um auf die Router-Einstellungen zuzugreifen. In den meisten Heimnetzwerken ist das eine der folgenden Adressen:
- 192.168.1.1
- 192.168.0.1
- 192.168.178.1 (häufig bei Fritzboxen)
- 10.0.0.1
Auf Windows findest du sie mit „ipconfig“ unter „Standardgateway“. Auf Mac und Linux mit „ip route“ oder „netstat -rn“. Die Router-IP wird auch als „Gateway“ bezeichnet.
IP-Adresse verbergen oder ändern – geht das und wie?
Ja, das geht definitiv! Es gibt mehrere Gründe, warum du deine IP-Adresse verbergen oder ändern möchtest: Mehr Privatsphäre, Umgehung von Geo-Blocking, Schutz vor Tracking, oder einfach mehr Sicherheit beim Surfen in öffentlichen WLANs.
VPN: Die beliebteste Methode
Ein VPN (Virtual Private Network) ist die gängigste und zuverlässigste Methode, um deine IP-Adresse zu verbergen. Ein VPN funktioniert so: Statt direkt mit einer Website zu kommunizieren, baust du erst eine verschlüsselte Verbindung zu einem VPN-Server auf. Dieser Server ruft dann die Website für dich auf und leitet die Daten verschlüsselt an dich weiter. Die Website sieht nur die IP-Adresse des VPN-Servers, nicht deine echte IP.
Vorteile eines VPNs:
Du kannst einen Server in fast jedem Land wählen und sozusagen virtuell umziehen. Möchtest du auf Inhalte zugreifen, die in Deutschland gesperrt sind? Wähle einen Server in den USA. Willst du deutschen Content aus dem Ausland abrufen? Wähle einen deutschen Server.
Die Verbindung zwischen dir und dem VPN-Server ist verschlüsselt, das schützt dich besonders in unsicheren öffentlichen WLANs. Dein Internetanbieter kann nicht mehr sehen, welche Websites du besuchst – er sieht nur, dass du mit einem VPN-Server verbunden bist.
Websites und Werbenetzwerke können dich nicht mehr so leicht über deine IP-Adresse tracken. Allerdings nutzen sie andere Methoden wie Cookies und Browser-Fingerprinting, ein VPN allein macht dich also nicht komplett unsichtbar.
Beliebte VPN-Anbieter sind: NordVPN, ExpressVPN, Surfshark, ProtonVPN, Mullvad und viele andere. Die meisten kosten zwischen 3 und 10 Euro pro Monat. Es gibt auch kostenlose VPNs, aber Vorsicht: Diese finanzieren sich oft durch Werbung oder den Verkauf deiner Daten – also genau das, was du eigentlich verhindern wolltest.
Wichtig zu wissen: Ein VPN verlangsamt deine Internetverbindung etwas, weil die Daten einen Umweg nehmen und ver- und entschlüsselt werden müssen. Gute Anbieter haben aber schnelle Server, sodass du das im Alltag kaum merkst.
Proxy-Server: Die einfache Alternative
Ein Proxy ist ähnlich wie ein VPN, aber einfacher und meist weniger sicher. Dein Browser leitet den Traffic über einen Proxy-Server um, der seine eigene IP-Adresse verwendet. Im Gegensatz zum VPN ist die Verbindung aber oft nicht verschlüsselt, und nur der Browser-Traffic wird umgeleitet, nicht der Traffic anderer Programme.
Proxies sind gut für einfaches Geo-Unblocking, aber nicht für ernsthafte Privatsphäre oder Sicherheit. Es gibt kostenlose Web-Proxies, die du direkt im Browser nutzen kannst, aber diese sind oft langsam und unzuverlässig.
Tor: Die ultimative Anonymität (aber langsam)
Das Tor-Netzwerk (The Onion Router) ist die radikalste Lösung für Anonymität. Dein Traffic wird durch mehrere zufällig ausgewählte Server (Nodes) auf der ganzen Welt geleitet, und jede Verbindung ist mehrfach verschlüsselt. Selbst die Nodes wissen nicht, wo die Daten herkommen und wohin sie gehen.
Vorteile von Tor:
Extrem hohe Anonymität, selbst staatliche Überwachung hat hier Schwierigkeiten. Zugang zum sogenannten Dark Web, falls du das aus journalistischen oder Forschungsgründen brauchst.
Nachteile:
Sehr langsam, weil die Daten so viele Stationen durchlaufen. Nicht geeignet für Streaming oder Downloads. Manche Websites blockieren Tor-Nutzer. Etwas komplizierter in der Nutzung.
Tor nutzt du am besten über den Tor Browser, der auf Firefox basiert und für Windows, Mac und Linux verfügbar ist.
Mobile Daten statt WLAN
Eine einfache Methode, deine IP zu ändern, ist der Wechsel zwischen verschiedenen Netzwerken. Wenn du vom Heimnetzwerk zu mobilen Daten wechselst, bekommst du eine andere IP-Adresse. Das ist zwar keine Verbergung, aber manchmal praktisch, wenn du etwa eine Website-Sperre umgehen möchtest, die auf deiner IP basiert.
Router neu starten (für dynamische IPs)
Wenn du eine dynamische IP-Adresse hast, kannst du sie manchmal einfach durch einen Router-Neustart ändern. Schalte deinen Router aus, warte 10 bis 30 Minuten, und schalte ihn wieder ein. In vielen Fällen bekommst du dann eine neue IP-Adresse von deinem Provider zugeteilt.
Das funktioniert aber nicht immer – manche Provider behalten die IP-Adresse für 24 Stunden oder länger bei. Trotzdem ist es einen Versuch wert, wenn du schnell eine neue IP brauchst.
Was du nicht tun solltest
Kostenlose VPNs mit Vorsicht genießen: Wie gesagt, viele finanzieren sich durch den Verkauf deiner Daten oder zeigen aggressive Werbung. Wenn du schon ein VPN nutzt, dann ein vertrauenswürdiges, am besten ein kostenpflichtiges oder eines mit gutem Ruf wie ProtonVPN (hat eine begrenzte kostenlose Version).
Öffentliche Proxies meiden: Diese sind oft unsicher, können deinen Traffic mitschneiden oder sogar mit Malware infiziert sein.
Browser-Fingerprinting nicht vergessen: Selbst mit veränderter IP kannst du über deinen Browser-Fingerprint getrackt werden – eine Kombination aus Browserversion, installierten Plugins, Bildschirmauflösung, Schriftarten und vielem mehr. Zusätzlich zum VPN kannst du Privacy-Tools wie uBlock Origin, Privacy Badger oder den Brave Browser nutzen.
Fazit: IP-Adressen – unverzichtbar, aber nicht unfehlbar

IP-Adressen sind das Fundament des Internets. Ohne sie würde nichts funktionieren – keine Website, kein Stream, keine E-Mail. Sie sind deine digitale Postanschrift, die dafür sorgt, dass Datenpakete den Weg zu dir finden und du dich mit der ganzen Welt vernetzen kannst.
Gleichzeitig sind IP-Adressen auch ein Werkzeug für Tracking, Überwachung und Geotargeting. Die gute Nachricht: Du musst kein Experte sein, um deine Privatsphäre zu schützen. Mit einem guten VPN, ein paar Browser-Erweiterungen und gesundem Menschenverstand kannst du selbst entscheiden, wann und wie du deine digitale Identität preisgeben möchtest.
Der Wechsel von IPv4 zu IPv6 wird sich in den kommenden Jahren weiter beschleunigen. Bis 2030 wird IPv6 wahrscheinlich der Standard sein. Das bringt nicht nur mehr Adressen, sondern auch technische Verbesserungen wie bessere Sicherheitsfunktionen und effizienteres Routing. Als Nutzer wirst du davon aber kaum etwas merken – das Internet wird einfach weiter funktionieren, nur besser.
Was bleibt ist die Erkenntnis: IP-Adressen sind mehr als nur technische Nummern. Sie sind ein wichtiger Teil deiner digitalen Identität und deiner Online-Privatsphäre. Es lohnt sich, zu verstehen, wie sie funktionieren und wie du sie zu deinem Vorteil nutzen kannst.
Ich hoffe, dieser Deep-Dive hat dir geholfen, IP-Adressen besser zu verstehen! Wenn du Fragen hast oder mehr über verwandte Themen wie VPNs, Firewalls oder Netzwerksicherheit erfahren möchtest, schreib es gerne in die Kommentare. Und falls du noch nicht meinen DNS-Blogpost gelesen hast – das ist die perfekte Ergänzung zu diesem Artikel!
Bleib neugierig und surf sicher!